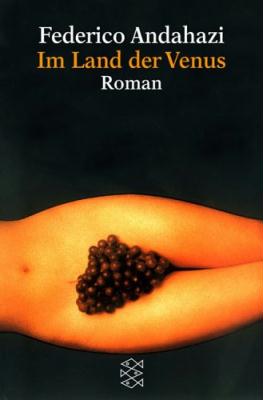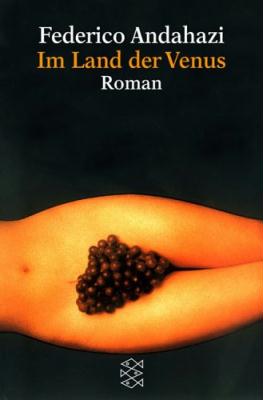 Federico Andahazis "Im Land der Venus"
Federico Andahazis "Im Land der Venus"
Schon 2001 im Fischer Verlag publiziert, rutschte es in einen Stapel schon gelesener, entfernt abgelegter Bücher und tauchte erst vor zwei Wochen und somit verspätet wieder auf: Andahazis Roman, der bei seinem Erscheinen 1997 in Argentinien einen Skandal auslöste und binnen einer Woche die dortigen Bestsellerlisten im Sturm nahm. Soweit die Information auf dem Bucheinband.
Beim Lesen sucht das Auge nach dem Skandal, dem Stein des Anstoßes, und wird scheinbar nicht fündig. Der historische Roman behandelt ein mittelalteriches Tabu, symbolisiert im
Amor Veneris, dem geheimnisvollen Organ, das der Protagonist des Werkes am weiblichen Genital entdeckt. Schon im Voraus ahnt bzw. weiß der Leser, dass es sich bei diesem Organ um die Kliltoris handelt.
Eingebettet in die Psychologie der frühen Renaissance, überschattet vom langen Arm der Inquisition, begibt sich der Anatom Matteo Realdo Colombo, amüsant in Bezug gesetzt zu seinem populären Namensvetter, der 50 Jahre zuvor den neuen Kontinent entdeckte, auf die Suche nach seinem "Amerika" und findet es zwischen den Schenkeln der Frauen. Die Schlußfolgerungen, die er aus der Entdeckung dieses Organs zieht, machen den Skandal aus - einen umfassenden in den Augen der Inquisition, dessen Ausmaß nur noch in sanftem Abebben den modernen Leser erreicht. Doch grade in der skurillen und brutalen Ignoranz der Inquisition schimmert der eine Tropfen von Matteos entdecktem Neuland heraus, setzt sich fest und bleibt bis heute Mysterium, Instrument der Macht, ein Tor zum Palast des Unbekannten. Die moderne Betrachtungsweise des Lesers (und vor allem des männlichen Lesers) wird instrumentalisiert, um den subtilen Keim einer Gralssuche zu implantieren, der auch Matteo, den Anatom, beständig antreibt.
Kaum ein Buch hat in mir den Eindruck erweckt, derart unterschiedlich auf weibliche und männliche Leser(innen) zu wirken und es bleibt im Grunde ein Buch über die beständige Unrast des Männlichen, die, seit es Literatur gibt, immer ein hervorragendes Motiv abgab.
Der Spiegel resümierte in seiner damaligen Kritik, Andahazi sei ein "Hochbegabter, der Patrick Süßkind und Garcia Márquez gründlich studiert" habe. Eine Anlehnung an Eco ist jedoch viel stärker herauszulesen. Weit entfernt davon, Ecos Verschachtelungen und Mysterienkonstruktionen zu bemühen (oder: zu beherrschen), insistiert der Autor auf dem Verborgenen, dessen Einfachheit am Ende eben jene lucide Verblüffung auslöst, die Ecos Romanen zugrunde liegt. Andahazis Sprache ist einfacher, schörkelloser, eingängiger; sie spiegelt den Versuch des Verstandes wieder, das Unfaßbare zu begreifen. Ungarischer Abstammung, versteht Federico Andahazi es, dem "Lateinischen Stil" eine Komponente zuzuführen, die im Fabelhaften und Archetypischen wurzelt. Außerordentlich gelungen ist diese Fusion, in der typisch südslawische und ungarische Bildabstraktion in die elegante, feinschleifende Sprache lateinischer Dominanz wie in einem Tanz geführt wird; ein Stil, der "Im Land der Venus" noch zu selten aufleuchtet, im letzten Kapitel jedoch eindrücklich brilliert. Der Skandal aber, der, einem Virus gleich, als resistente Infektion im Bewußtsein zurückbleibt, ist das Unverständnis der Geschlechter füreinander. So sehr wir auch aus der rational überlegenen Sicht der Moderne auf die unwissenden Protagonisten des Romans hinabsehen, sind wir dem Mysterium doch nur scheinbar näher gekommen: Ohne den Schleier zu lüften.
Rubrik: Rezensionen
TheSource - 16. Aug, 15:36

Zu Milos Okukas "Eine Sprache, viele Erben"
Sprache als Machtinstrument
Es gibt wenige Bücher, die den Zerfall Jugoslawiens und dessen dramatische Folgen so profund ausleuchten wie Miloš Okukas Studie über «Sprachpolitik als Nationalisierungsinstrument in Ex-Jugoslawien». Okuka, als Slawist ehemals in Sarajewo tätig, heute Dozent an der Universität München, holt historisch weit aus: Er beschreibt die langwierige, politisch begründete Herausbildung einer serbokroatischen Schriftsprache im 19. Jahrhundert, die mit dem Wiener Sprachabkommen von 1850 Konturen annahm, zeichnet die in der Folge ständig aufflammenden Kämpfe zwischen Unitaristen und Separatisten nach, um anhand der Entwicklungen der letzten Jahre seine These zu bekräftigen, dass Sprache ideologischen Manipulationen unterliegt und im Extremfall zur Waffe verkommt. «Dem Krieg im früheren Jugoslawien ging ein Medienkrieg voraus, der mit der Gewalt gegen die Sprache die Gewalt in der Praxis, die ethnischen Säuberungen vorbereitete.»
Heute, nach vollendeten «Nationalisierungen», ist die Sprache selbst als Opfer zu beklagen. Das ehedem gemeinsame Serbokroatische, das sich zweier Alphabete und zweier Aussprachen bediente, ist dem Serbischen, Kroatischen und Bosnischen gewichen. Aus zwei «streng polarisierten Kulturdialekten», wie es linguistisch korrekt heisst, sind – politisch forciert – drei Sprachen geworden. Der Prozess, bei dem Wörterbücher und Grammatiken die Rolle von Kampfschriften übernahmen, entbehrt nicht tragikomischer Aspekte. Geradezu absurd mutet die Manipulation der Lexik an: Wortneuschöpfungen oder Rückgriffe auf Archaismen im Kroatischen, Belebung und Ausweitung der Turzismen im Bosnischen. Bei den Eigennamen bedeutet solche Abgrenzung in praxi, dass je nach politischer Opportunität ein Dušan zum Duško, eine Jovanka zur Ivanka wird. Denn Patriotismus und Loyalität werden neuerdings am richtigen Sprachgebrauch gemessen. Wehe dem, der sich verrät; es kann ihn teuer zu stehen kommen.
Okukas sorgfältig recherchierte Studie zeigt freilich auch, dass solche «rassistische» Instrumentalisierung der Sprache auf eine lange Tradition zurückblicken kann. Anders ausgedrückt: Standardsprachen entstehen nicht auf Grund linguistischer Kriterien, sondern auf Grund sprachpolitischer Entwicklungen. Ein ernüchternder Befund.
(Neue Züricher Zeitung)
 [In den letzten Jahren habe ich Hundertschaften neuer/alter Vokabeln gelernt, welche die ehemals gängigen Worte in Gesamtjugoslavien nun "rein kroatisch" ersetzen, jedoch nie antiquiert waren, da die Seperatisten immer auch durch den Sprachgebrauch ihre Position verdeutlichten. Es ist ein schwer zu erklärendes, psychologisches Moment: Als Kroatin in Zagreb ein serbisches Wort zu benutzen kommt in gewißer Weise einem Spucken auf die Gräber der kroatischen Soldaten gleich. So inetwa ist die Reaktion der Umwelt. Einer Serbin wird dies, aus ethnischen Gründen, zugestanden, mir niemals; semantischer Hochverrat - und dies ist keinesfalls eine Übertreibung. So also überdenke ich, die sich frei Wähnende, jeden Satz in meiner Muttersprache drei Mal, bevor er meine Lippen verlässt]
[In den letzten Jahren habe ich Hundertschaften neuer/alter Vokabeln gelernt, welche die ehemals gängigen Worte in Gesamtjugoslavien nun "rein kroatisch" ersetzen, jedoch nie antiquiert waren, da die Seperatisten immer auch durch den Sprachgebrauch ihre Position verdeutlichten. Es ist ein schwer zu erklärendes, psychologisches Moment: Als Kroatin in Zagreb ein serbisches Wort zu benutzen kommt in gewißer Weise einem Spucken auf die Gräber der kroatischen Soldaten gleich. So inetwa ist die Reaktion der Umwelt. Einer Serbin wird dies, aus ethnischen Gründen, zugestanden, mir niemals; semantischer Hochverrat - und dies ist keinesfalls eine Übertreibung. So also überdenke ich, die sich frei Wähnende, jeden Satz in meiner Muttersprache drei Mal, bevor er meine Lippen verlässt]
Post scriptum: Ich möchte, aus Gründen der Vollständigkeit, noch eine andere Ebene hinzufügen (eine von vielen), die ebenfalls einer Betrachtungsweise der sich frei Wähnenden zum Thema entspricht. Hierzu lasse ich ein Bild sprechen:

TheSource - 1. Aug, 00:06
HÜTE DICH VOR DETAILS
Der kroatische Schriftsteller Miljenko Jergovic
»Der Krieg hat mich gelehrt, Gefühle und Nerven künstlich ruhig zu halten. Wenn einer anfängt, von irgendwelchen Sachen zu erzählen, die mich besonders mitnehmen könnten, geht irgendwo in meinem Innern ein rotes Lämpchen an, wie jenes, das Geräusche bei der Aufnahme wegfiltert, und ich empfinde nichts mehr« Die Geschichte "Der Kaktus" aus dem Band Sarajevo Marlboro erzählt von einem merkwürdigen Geschenk, das die Freundin des Ich-Erzählers ihrem Liebsten zum Neujahr 1990 macht; ihm, der Pflanzen im Zimmer hasst. Zu seiner eigenen Überraschung wird das stachlige Präsent zu etwas, das er hegt und pflegt. Als die Kaktusschenkerin kurz nach Kriegsbeginn in Sarajevo die Stadt verlässt, steigt der Zurückgebliebene regelmäßig aus dem Bombenkeller in die Wohnung, um den Kaktus zu gießen, bis er ihn, bei Frosteinbruch, in den Keller nimmt. Dort geht er ein. »...wenn ich an den Kaktus denke,« schließt die Geschichte, »hilft gar nichts. Er ist wie ein winziges Derivat der Trauer, nur scheinbar ungefährlich, eine bittere Mandel Zyankali ... Aber die Sache ist nicht so wichtig, außer als Mahnung, dass man sich im Leben vor Details hüten soll. Und vor nichts anderem.«
Sich vor Details hüten. Ein Credo, das, freilich mit umgekehrten Vorzeichen, als Leitsatz der Geschichten des bosnischen Kroaten Miljenko Jergovic gelten kann. An Details hängt er seine Geschichten auf. Details enthalten ganze Geschichten. Ein Kaktus, ein Ring, eine Zigarettenschachtel. Oder, in einer anderen Geschichte, ein Apfelbaum, üppig tragend wie nie in dem Jahr, als er den Tschetnik-Stellungen gegenüber steht; der Apfelbaum, den die Nachbarn des Erzähler-Ichs nicht anzufassen wagen, obwohl er bei ihnen ins Fenster wächst, dorthinein, wo sie an Verwundungen und Verleumdungen ihrer Umgebung langsam vor sich hinsterben.
Miljenko Jergovic ist 1966 in Sarajevo geboren. Schon als Jugendlicher trat er schreibend an die Öffentlichkeit: Als kulturpolitischer Kolumnist in den verschiedensten Jugendmedien, mit kaum über 20 als Moderator einer eigenen Sendung, als Lyriker mit frühen Publikationen. 1990 wurde er ausgezeichnet mit dem Veselko-Tenzera-Preis als bester politischer Kolumnist Jugoslawiens. »Politisch schreiben damals und politisch schreiben heute, dazwischen liegen natürlich Welten«, beschreibt Jergovic´s kroatischer Verleger und Initiator der Gruppe 99, Nenad Popovic. »Die Politik hat uns erobert. Von ganz normalen Leuten sind wir zu Spezialisten für Völkermord geworden«. In Popovic´s Verlag Durieux begann der seit 1993 in Zagreb lebende Jergovic, seine Erzählbände zu publizieren: Sarajevski Marlboro (1994/dt. 1996), Karivani (dt. 1997) und Mama Leone (1998/dt. 2000). Zugleich wurde er »in Kroatien als frecher Kommentator der Tudjman-Politik zum enfant terrible« (Popovic) und zum Kolumnisten in verschiedenen Oppositionsblättern. Letzteres ist Jergovic immer noch, neben einer festen Anstellung bei der Zagreber Feral Tribune. Auch nach dem Krieg geht es um Krieg und Tod, denn Jergovic ist ein Erinnerer und Aufbewahrer, der desto genauer erinnert, je hastiger etwas ins Vergessen befördert werden soll. Man könne ihn einstellen als »Registrator verschwundener Völker und Verlage«, schreibt er nach einem Rundgang auf der Frankfurter Buchmesse in der FAZ.
Der Essayist und Kolumnist Jergovic ist im deutschsprachigen Raum nur sehr vereinzelt zu lesen. Im 2000 erschienenen Sammelband Verteidigung der Zukunft schreibt er über die Unmöglichkeit von Zukunft, solange »das Opfer Rache nimmt an seinem Henker.«
»MiloŠevic hat sein Volk nur deshalb auf Schlachtfeste geführt, damit dieses Volk selbst geschlachtet wird, nur deshalb, damit das ununterbrochene Töten seine einzige Existenzmöglichkeit wird. Indem er das tat, machte er es unempfindlich für den Schmerz, die Unempfindlichkeit für den Schmerz aber ist der vorletzte Akt des Untergangs.«
Auf dem Weg von Sarajevo Marlboro(1996) zu Mama Leone(2000) haben die Erzählungen von Miljenko Jergovic eine Haut abgeworfen, unter der das Erzählte noch unmittelbarer für sich spricht: Analyse oder Fazit sind überflüssig geworden. Mama Leone entwirft in seinem ersten Teil einen größeren Zusammenhang: Unter der Überschrift Als ich geboren wurde, bellte auf dem Flur der Entbindungsanstalt ein Hund sind 22 eng zusammenhängende autobiographische Geschichten zu einem Zyklus zusammengefasst.
Tod und Lüge sind auf tückische Art miteinander verschwistert, lernt das Kind, von dem uns Miljenko Jergovic hier erzählt. Erst sind die Menschen da und dann plötzlich weg, auf Nimmerwiedersehen, und alle pressen die Lippen zusammen und schweigen darüber. So geht es mit dem Großvater, so geht es mit den neugeborenen Kätzchen, denen Baka, die Großmutter, erst auf die Welt geholfen hatte, um sie danach in der Stille des Badezimmers, den Augen des Kindes entzogen, zu ertränken. So geht es mit dem Großonkel, der stirbt, bevor er dem Kind die versprochene Armbanduhr schenkt, und warum soll es dann nicht auch mit der Mutter so gehen, die zur Abklärung eines »Wündchens am Gebärmutterhals« nach Ljubljana fährt, wieder vom sorgenvollen, nur heimlich belauschten Flüstern der übrigen Familie begleitet. »Wündchen war ein kleines Wort, wie Autochen, Würfelchen oder Steinchen, aber es bedeutete etwas Schreckliches. Früher hatte es solche Worte nicht gegeben: Bis zu diesem Wündchen war alles Kleine harmlos und lieb gewesen, winzig für die Augen und lieb zum Ansehen, doch das war jetzt anders geworden ... Für meine kleinen Dinge und ihr Gutsein war das Ende gekommen: Die Welt würde sich nicht mehr in Diminutiven verstecken ...« Die Klarheit über Tod und Lüge und den Zusammenhang zwischen ihnen ist etwas, zu dem schon das Kind gelangt, das Jergovic in seinem ersten Buch nach Ende des Krieges erinnert. Ein Kind, vollgestopft mit verschwiegenem und verheimlichtem Tod, alt geworden vor seiner Zeit, und misstrauisch gegenüber allem Anfang. »Die Lüge ist lebendig, dachte ich, sie verschluckt die Dinge und kann alles anders machen als es ist.« Es ist keine schreckliche Kindheit, von der Miljenko Jergovic erzählt. In die Sprache der Verlorenheit ist die Sprache der Geborgenheit gemischt, untrennbar voneinander. Aber Jergovic, der Chronist der kleinen Dinge, schenkt seine Aufmerksamkeit jenen Momenten kindlichen Grauens, die die Erwachsenen lachend kommentieren: Ist doch nicht so schlimm! »War doch nicht so schlimm«, sagt man, groß geworden, selber. Doch, sagt Jergovic, jenseits von Verhärtung und Sentimentalität, doch, es war furchtbar schlimm. Und erzählt die kindlichen Schrecken als das, was sie sind, nämlich die Grundlage von Entscheidungen, wie einer in seinem Leben umgehen wird mit Angst und Wahrheit und Tod und seinen Nächsten. Nicht fertig werden, heißt die Botschaft, die man aus Jergovics Geschichten entnehmen kann. Jene Details aufsuchen, in denen sich Verletzbarkeit verbirgt.
»Who will be the witness« hatte das Motto über dem dritten »aus einer einzigen Geschichte bestehenden« Teil in Sarajevo Marlboro geheißen. Miljenko Jergovic ist in frühem Alter zum Chronisten von etwas geworden, das jenseits des Krieges Lebende nicht kennen; dennoch wird es immer wieder möglich, sich in seinen Geschichten wiederzuerkennen, jener Dokumentation von Momenten der verfehlten, der verlorenen, der ersehnten Empfindlichkeit.
(B.C./T.M.)
Miljenko Jergovic: Sarajevo Marlboro. Erzählungen. Aus dem Kroatischen von Klaus Detlef Olof. Folio-Verlag, Wien-Bozen 1996. 129 S.
Freimut Duve/Nenad Popovic: Hg.: Verteidigung der Zukunft. Suche im verminten Gelände. Aus dem Kroatischen von Klaus Detlef und Detlev I. Olof. Folio-Verlag, Wien-Bozen 1999. 187 S.
Miljenko Jergovic: Mama Leone. Erzählungen. Aus dem Kroatischen von Klaus Detlef Olof. Folio-Verlag, Wien-Bozen 2000. 315 S.
TheSource - 20. Apr, 19:06